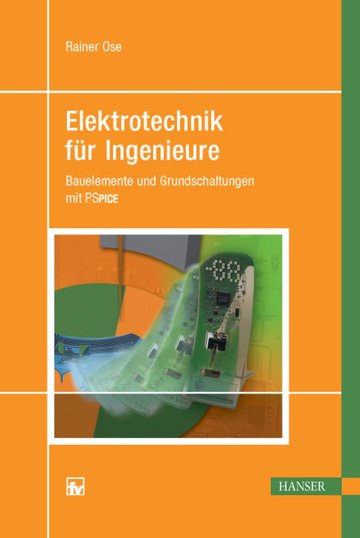| Vorwort | 6 |
| Inhaltsverzeichnis | 7 |
| 1 Grundlagen der Elektrotechnik mit PSPICE | 10 |
| 1.1 Kurzeinführung in PS PICE | 10 |
| 1.1.1 Zeichnen einer Schaltung | 10 |
| 1.1.2 Setzen von Bauelemente-Attributen | 11 |
| 1.1.3 Simulation von Projekten | 12 |
| 1.1.4 Auswertung von Simulationen | 12 |
| 1.2 Simulation von Gleichstromkreisen | 13 |
| 1.2.1 DC-Main-Sweep-Funktionen | 14 |
| 1.2.2 Funktionen des PROBE -Fensters | 16 |
| 1.2.3 DC-Nested-Sweep-Funktionen | 18 |
| 1.3 Simulation von Wechselstromkreisen | 21 |
| 1.3.1 Darstellung von Zeitfunktionen | 22 |
| 1.3.2 Überlagerung von Zeitfunktionen | 24 |
| 1.3.3 Messung elektrischer Größen | 26 |
| 1.3.4 AC-Sweep-Funktionen | 27 |
| 1.3.5 AC-Parametric-Sweep | 30 |
| 1.3.6 Dreiphasensystem | 35 |
| 1.3.7 Transformator | 36 |
| 1.4 Simulation von Schaltvorgängen | 38 |
| 1.4.1 Auf- und Entladen von RC-Kombinationen | 38 |
| 1.4.2 Umschalten vorgeladener Kondensatoren | 41 |
| 1.4.3 Ladungsausgleichsvorgänge | 43 |
| 1.4.4 Schaltvorgänge in RL-Kombinationen | 46 |
| 1.4.5 Schaltvorgänge in RLC-Kombinationen | 47 |
| 1.5 Simulationsbeispiele | 49 |
| Simulationsbeispiel 1.1: Netzwerkberechnung | 49 |
| Simulationsbeispiel 1.2: Überlagerungssatz und Zweipoltheorie | 51 |
| Simulationsbeispiel 1.3: RC-Phasenkette | 53 |
| Simulationsbeispiel 1.4: Komplexe Übertragungsfunktion | 55 |
| Simulationsbeispiel 1.5: Leistung im Wechselstromkreis | 56 |
| Simulationsbeispiel 1.6: Leistungsanpassung im Wechselstromkreis | 58 |
| Simulationsbeispiel 1.7: Dreiphasensystem | 60 |
| Simulationsbeispiel 1.8: Transformator | 63 |
| Simulationsbeispiel 1.9: Umschalten vorgeladener Kondensatoren | 64 |
| Simulationsbeispiel 1.10: Spannungsverdoppler | 68 |
| Simulationsbeispiel 1.11: Ladungsausgleich | 69 |
| Simulationsbeispiel 1.12: Selbstinduktion | 71 |
| Simulationsbeispiel 1.13: Induktivitätsbestimmung | 73 |
| 2 Passive Bauelemente | 76 |
| 2.1 Klassifikationskriterien | 76 |
| 2.2 Grundbauelemente | 79 |
| 2.2.1 Widerstände | 79 |
| 2.2.1 Widerstände | 79 |
| 2.2.2 Kondensatoren | 83 |
| 2.3 Homogene Halbleiter | 102 |
| 2.3.1 Halbleiter-Übersicht | 102 |
| 2.3.2 Thermistoren | 107 |
| 2.3.3 Varistor | 111 |
| 2.3.4 Fotowiderstand | 113 |
| 2.3.5 Magnetfeldabhängige Halbleiter | 115 |
| 2.4 Halbleiter-Dioden | 124 |
| 2.4.1 pn-Übergang | 124 |
| 2.4.2 Universaldiode | 126 |
| 2.4.2 Universaldiode | 126 |
| 2.4.3 Simulation von Halbleiter-Dioden | 128 |
| 2.4.4 Gleichrichterdioden | 132 |
| 2.4.5 Schaltdioden | 136 |
| 2.4.6 Z-Diode | 142 |
| 2.4.7 Varaktor-Dioden | 146 |
| 2.4.8 pin-Diode | 148 |
| 2.4.9 S CHOTTKY -Diode | 148 |
| 2.5 Simulationsbeispiele | 150 |
| 3 Aktive Bauelemente | 169 |
| 3.1 Eigenschaften | 169 |
| 3.2 Unipolare Transistoren | 170 |
| 3.2.1 Sperrschicht-FET | 171 |
| 3.2.2 MOS-FETs | 173 |
| 3.2.3 Leistungs-MOS-FETs | 176 |
| 3.2.4 Kenngrößen von FETs | 177 |
| 3.2.5 PSPICE-Modelle von Feldeffekttransistoren | 178 |
| 3.2.6 Elementare Anwendungen von Feldeffekttransistoren | 185 |
| 3.3 Bipolare Transistoren | 191 |
| 3.3.1 Aufbau und Wirkungsweise | 191 |
| 3.3.2 Kennlinienfelder | 193 |
| 3.3.3 Statische Kenngrößen | 194 |
| 3.3.4 Dynamische Kenngrößen | 196 |
| 3.3.5 Arbeitspunkteinstellung | 201 |
| 3.3.6 Arbeitspunktstabilisierung | 202 |
| 3.3.7 PSPICE-Modelle von bipolaren Transistoren | 206 |
| 3.3.8 Frequenzabhängigkeiten | 210 |
| 3.3.9 Elementare Anwendungen | 216 |
| 3.4 Thyristoren | 226 |
| 3.4.1 Aufbau und Wirkungsweise | 226 |
| 3.4.2 Kennlinie und Kenngrößen | 228 |
| 3.4.3 PSPICE -Modelldaten | 230 |
| 3.4.4 Thyristor als Schalter | 233 |
| 4 Optoelektronische Halbleiterbauelemente | 260 |
| 4.1 Einteilung optoelektronischer Bauelemente | 260 |
| 4.2 Strahlungskenngrößen | 261 |
| 4.2.1 Radiometrische Größen | 261 |
| 4.2.2 Fotometrische Größen | 261 |
| 4.3 Fotodetektoren | 262 |
| 4.3.1 Fotowiderstand | 263 |
| 4.3.2 Fotodiode | 263 |
| 4.3.4 Fototransistor | 266 |
| 4.3.5 Fotothyristor | 269 |
| 4.4 Fotoaktoren | 270 |
| 4.4.1 Lumineszenzdiode | 270 |
| 4.4.2 Optokoppler | 273 |
| 4.5 Berechnungs- und Simulationsbeispiele | 275 |
| 5 Operationsverstärker | 281 |
| 5.1 Grundprinzip eines Operationsverstärkers | 281 |
| 5.2 Kenngrößen des Operationsverstärkers | 283 |
| 5.3 Ideales und reales Verhalten eines Operationsverstärkers | 291 |
| 5.3.1 Ruhestrom-Kompensation | 291 |
| 5.3.2 Offset-Kompensation | 292 |
| 5.3.3 Frequenzgang-Korrektur | 292 |
| 5.4 Grundschaltungen mit OV | 294 |
| 5.4.1 Invertierender Verstärker | 294 |
| 5.4.2 Nichtinvertierender Verstärker | 295 |
| 5.5 Analoge Rechenschaltungen | 298 |
| 5.5.1 Summenverstärker | 298 |
| 5.5.2 Differenzverstärker | 299 |
| 5.5.3 Differenzierer | 300 |
| 5.5.4 Integrierer | 301 |
| 5.6 Komparatoren | 303 |
| 5.7 Konstantstromquellen | 306 |
| 5.8 Spitzenwertgleichrichter | 307 |
| 5.9 Aktive Filter | 309 |
| 5.9.1 Tief- und Hochpässe | 309 |
| 5.9.2 Bandpassschaltungen | 318 |
| 5.10 Simulationsbeispiele | 326 |
| Anhang | 355 |
| A_1: Hinweise zur PSPICE- Evaluationssoftware | 355 |
| A_2: Hinweise zur Schreibweise in PSPICE | 355 |
| A_3: Häufige Fehlermeldungen von PSPICE | 357 |
| A_4: Erstellung einer PSPICE- Netzliste | 358 |
| Literaturverzeichnis | 359 |
| Sachwortverzeichnis | 361 |